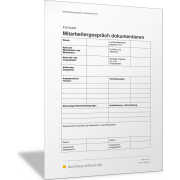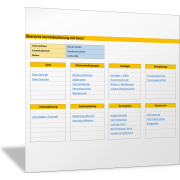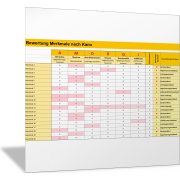EntscheidenMögliche Fehlentscheidungen kennen und vermeiden
Warum kommt es zu falschen Entscheidungen?
Mit Entscheidungen und der Frage, wie sie fallen, befassen sich viele Experten. Der „Stein der Weisen“ dafür wurde noch nicht gefunden. Wer lange und aufwendig nach der richtigen Entscheidung sucht, sollte sein Augenmerk lieber darauf lenken, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, eine falsche Entscheidung zu treffen.
Schon bei der Entscheidungsfindung werden Fehler gemacht. Eine Quelle ist der Entscheidungsprozess selbst, der schlecht durchgeführt wird. Aus folgenden Gründen:
- Alternativen der Entscheidung sind nicht klar herausgearbeitet.
- Entscheidungsrelevante Informationen werden nicht gefunden oder missachtet.
- Kosten- und Nutzenfaktoren werden schlecht gegeneinander abgewogen und gewichtet.
Eine andere Quelle für Fehlentscheidungen sind das Denkverhalten und die Denkgewohnheiten der Entscheider. Sie sind meist fest im Unterbewusstsein verdrahtet und werden als Heuristiken bezeichnet.
In vielen Lebens- und Arbeitsbereichen liefern sie gute bis sehr gute Ergebnisse. Aber manchmal sind sie auch hinderlich, weil Entscheidungen erschwert werden. Und manchmal sind sie gefährlich, weil Erfahrungen fehlen und die Heuristik in die Irre führt.
Phasen der Entscheidungsfindung
Um zu verstehen, wie es zu Fehlentscheidungen kommen kann, sollte der eigene Entscheidungsprozess bewusst gemacht werden. Üblicherweise läuft die Entscheidungsfindung in fünf Phasen ab.
Phase 1: Entscheidungssituation klären
In dieser ersten Phase der Entscheidungsfindung stellen Sie sich die Frage:
- Welches Ziel möchte ich, der Kunde oder die Geschäftsleitung mit der Entscheidung erreichen?
- Auf welche Beteiligten muss bei der Entscheidung Rücksicht genommen werden? Stakeholder, Mitarbeitende, andere Teams, Partner …
So legen Sie fest, welche Faktoren bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen. Dann klären Sie, worüber genau eine Entscheidung getroffen werden soll. Sie formulieren die Entscheidungsfrage.
Phase 2: Informationen gewinnen
In diesem Schritt sammeln Sie Informationen aus verschiedenen Quellen, werten diese aus, fassen zusammen und tauschen sich – je nach Situation – mit anderen aus.
Phase 3: Optionen abwägen und vergleichen
Nun entscheiden Sie sich zwischen den verschiedenen Alternativen, die nach der Recherche tatsächlich infrage kommen. Sie wiegen die Vor- und Nachteile gegeneinander auf. Vielleicht überlegen Sie sich auch, worauf Sie oder das Unternehmen verzichten könnten – zugunsten eines ausschlaggebenden Vorteils, wie der Kosten- oder der Zeitersparnis.
Phase 4: Unsicherheit und Zweifel
Nach dem Abwägen sind Sie zu einem Ergebnis gekommen. Die Entscheidung wird noch nicht gefällt. Wahrscheinlich fallen Ihnen in dieser Phase Argumente gegen die vorläufige Entscheidung oder die präferierte Option ein. Sie revidieren die vorläufige Entscheidung und greifen auf eine Alternative zurück.
Phase 5: Entscheiden oder nicht entscheiden
Wenn die Zeit drängt, entscheiden Sie sich für eine Lösung, die Ihnen in diesem Moment als die beste oder plausibelste erscheint.
Ist die Unsicherheit zu groß oder das Risiko zu hoch, treffen Sie keine Entscheidung. Oder Sie entscheiden bewusst: Alles soll beim Alten bleiben.
Die Entscheidungssituation wird falsch dargestellt
Ob jemand das halb volle oder das halb leere Glas sieht, ist sprichwörtlich. Genauso werden Entscheidungen dadurch beeinflusst, ob die Chancen oder die Risiken herausgestellt werden.
Deshalb kommt es im Entscheidungsprozess schon darauf an, wie die Entscheidungssituation beschrieben und wie die Entscheidungsfrage formuliert wird.
Beispiele für Entscheidungsfragen
Folgende Fragen beziehen sich beispielhaft auf eine Produkteinführung. Sie wollen Ihre Vorgesetzten oder das Entscheidungsgremium zu einer Entscheidung bringen. Dazu machen Sie eine der folgenden Aussagen, die den Kern Ihres Vorschlags deutlich machen sollen:
- Wenn wir das Produkt jetzt einführen, erzielen wir damit eine Million Euro Umsatz im ersten Jahr. Wollen wir mit der Produkteinführung starten?
- Die Produkteinführung kostet uns 500.000 EUR. Wollen wir das Budget für die Produkteinführung freigeben?
- Wenn wir das Produkt jetzt einführen, erhöhen wir unseren Gesamtumsatz auf sechs Millionen Euro (ohne sind es fünf Millionen Euro). Wollen wir diesen Umsatzanstieg realisieren?
- Wir können das Budget auf eine Million Euro reduzieren, wenn wir auf diese Produkteinführung verzichten. Wollen wir auf die Produkteinführung verzichten?
- Jedes fünfte Unternehmen scheitert bei der Einführung dieser Technologie. Wollen wir das Risiko mit dem neuen Produkt eingehen?
- Zu 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit bekommen wir die Technik zum Laufen. Wollen wir diese Chance ergreifen und mit dem neuen Produkt Vorreiter am Markt sein?
Sie sehen: Je nachdem, wie die Folgen der Entscheidung beschrieben werden, legen Sie eine Entscheidung mal dafür und mal dagegen nahe. Dabei sind die Fakten immer die gleichen.
Entscheidungsfragen richtig stellen
Wer Entscheidungen vorbereitet, sollte deshalb besonders darauf achten, wie er die Entscheidungsfrage stellt, welchen Aspekt er hervorhebt und von welchem Bezugspunkt aus er die Folgen vergleicht:
- Entscheidungsfrage in unterschiedlichen Formen stellen und hinterfragen, gerade wenn andere die Frage formuliert haben.
- Positive und negative Aspekte in gleicher und fairer Weise in der Fragestellung formulieren.
- Durch Sensitivitätsanalysen mit alternativen Formulierungen die Robustheit von Entscheidungen prüfen.
Wie Informationen in die Irre führen können
Informationen sind die Grundlage für Entscheidungen. Dabei gewinnen solche Informationen an Gewicht, die gerade präsent sind – weil sie zuerst auftauchten, noch in Erinnerung sind oder kurz vor einem Beschluss vorgestellt wurden.
Beispiele:
- Bei der Geschäftsplanung werden bestehende Trends einfach fortgeschrieben.
- Bei der Personalbeurteilung werden Kolleginnen und Kollegen nach ihrem ersten Eindruck beurteilt.
- Das Fazit einer Präsentation prägt die gesamte Diskussion.
Andere Informationen und Einflussfaktoren, die nicht präsent sind, werden übergangen oder gar nicht erst in Betracht gezogen. Diesen Anker-Effekt nutzen manche im Prozess der Entscheidungsfindung auch gezielt, indem sie vor allem die ihnen passenden Informationen berücksichtigen.
Falsche Prognosen als Grundlagen für Entscheidungen
Entscheidungen basieren zumeist auf Zahlen, die die Zukunft beschreiben. Umsätze, Kosten oder Erfolge werden geschätzt und prognostiziert. Doch niemand kann sicher behaupten, alles Prognostizierte werde auch so eintreten.
Wir haben gelernt, Geschwindigkeiten von Autos oder Mengen und Gewichte einzuschätzen. Aber bei Aktienkursen und Absatzzahlen gibt es derart viele Einflussfaktoren, dass Erfahrungen sich nur schwer bilden lassen. Der Zeitraum, nach dem die Güte der Schätzung sichtbar wird, ist einfach zu lang.
Das macht die Entscheidung noch schwieriger, denn kaum jemand hat Erfahrung, um beurteilen zu können, ob die Prognosen stimmen. Folgende Probleme werden sichtbar:
- Das Vertrauen, dass sich alles in gewohnten Bahnen bewegt, ist stark ausgeprägt. Große Abweichungen werden oft nicht vorhergesehen.
- Entscheider schätzen und prognostizieren so, dass sie notfalls „auf der sicheren Seite“ sind, etwa bei Absatzzahlen oder Kapazitätsbedarfen.
- Die Erinnerung an besondere Ereignisse oder persönliche Erlebnisse fließt in Schätzungen und Prognosen ein und kann diese verzerren.
Auch bei diesen Entscheidungsfallen ist es hilfreich, eine selbstkritische Position einzunehmen. Eigene Annahmen sollten hinterfragt und andere Kollegen oder Experten befragt werden. Insgesamt trägt dieses Vorgehen zur Klarheit und zur besseren Entscheidung bei.
Die falschen Fakten werden für die Entscheidung berücksichtigt
Wer zur Entscheidungsfindung Informationen für die Argumentation recherchiert, wählt oft solche aus, die der vorgefassten Meinung entsprechen. Was nicht passt, wird passend gemacht – oder einfach ausgeblendet.
Wer die Wahl einer Alternative scheut, greift auf den Rat von Experten zurück, die besonders deren Risiken sehen und betonen. Andere Ansichten werden nicht berücksichtigt oder abqualifiziert.
Dieses Verhalten hat seinen Grund: Menschen entscheiden meistens erst, was sie wollen, bevor sie sich die Gründe für die Wahl überlegen. Zum anderen haben sie eine Präferenz für das, was sie mögen. Und sie vermeiden, was sie nicht mögen.
Wie Sie die Entscheidungsfindung durch eine neutrale Betrachtung erleichtern
Mögliche Gegenmaßnahmen, um eine falsche Informationsverarbeitung zu vermeiden, sind:
- Sachverhalt zur Entscheidungsfindung immer unter mehreren und unterschiedlichen Aspekten besprechen
- gezielt Gegenpositionen beziehen (als Advocatus Diaboli)
- Sachverhalt für sich selbst bedenken, bevor Informationen anderer begutachtet werden
- Informationen aus unterschiedlichen Quellen von verschiedenen Personen betrachten und berücksichtigen
Nehmen Sie eine selbstkritische Haltung ein:
- Hinterfragen der vorgefassten Meinung: Welche Informationen, Argumente und Belege sprechen gegen die vorgefasste Meinung?
- Was sind die stärksten drei Gegenargumente?
- Meinung von Kritikern oder unbeteiligten Personen einholen, die wenig über den Entscheidungsfall wissen.
Warum fallen Entscheidungen schwer?
Die meisten Menschen mögen keine Veränderungen, denn sie bedeuten Risiko, Ungewissheit und Verantwortung. So werden viele Entscheidungen vordergründig nicht getroffen nach dem Motto: Das war schon immer so!
Ein Trugschluss, denn auch wenn scheinbar keine Entscheidung getroffen wird, so ist auch dies eine Entscheidung – dafür, dass nichts entschieden wird und (zunächst) alles bleibt, wie es ist.
Um das zu rechtfertigen, werden solche Informationen im Entscheidungsprozess herausgestellt, die negative Effekte der Veränderung oder ihre Risiken sichtbar machen sollen. Experimente zeigen, dass der Status quo umso attraktiver ist, je mehr Alternativen im Spiel sind.
Wenn Entscheider mehr als eine Möglichkeit haben, verharren sie oft beim Bestehenden.
Einige Unternehmen fördern dieses Verhalten und drohen mit Strafen, wenn ein Mitarbeiter Verantwortung übernimmt, Neues ausprobiert und eventuell scheitert. Wer hingegen nichts tut, wird dafür selten belangt.
Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Status quo kann in der Tat die beste Wahl sein. Nicht immer sind Veränderungen per se richtig. Folgende Überlegungen sind deshalb wichtig:
- Die Ziele müssen klar sein. Dann lässt sich prüfen, ob der Status quo dazu passt oder die Zielerreichung behindert.
- Der Status quo sollte wie alle anderen Alternativen betrachtet und im Entscheidungsprozess bewertet werden.
- Gedankenexperiment: Würde man den aktuellen Zustand als mögliche Alternative betrachten, wenn er nicht schon Realität wäre?
- Der Wandel vom Bestehenden zum Neuen ist immer mit Aufwand verbunden, doch dieser sollte nicht das einzige Kriterium im Entscheidungsprozess sein.
Fehlentscheidungen im Unternehmen erkennen
Viele Entscheidungen werden nicht isoliert getroffen, sondern stehen in einer Kette verknüpfter Entscheidungen. Dabei werden frühere Entscheidungen, die sich als schlecht herausgestellt haben, zu selten revidiert.
Das bedeutet: Die folgenden Entscheidungen werden so getroffen, dass die alten Fehler kaschiert und nicht behoben werden.
Für Unternehmen bedeutet das: Gutes Geld wird schlechtem hinterhergeworfen. Dabei sollten die sogenannten „Sunk Costs“ bei der Entscheidungsfindung keine Rolle spielen.
Oft trauen sich Entscheider jedoch nicht, sich einzugestehen, vorher einen Fehler begangen zu haben. Stattdessen richten sie ihre Entscheidungen daran aus. Schon Warren Buffett warnte: „Wenn du in einem Loch sitzt, ist das Beste, das du tun kannst, mit dem Graben aufzuhören.“
Wie Sie mit Fehlentscheidungen im Unternehmen umgehen
Beachten Sie folgende Regeln, damit fehlende oder Fehlentscheidungen Ihr Unternehmen nicht lähmen:
- Menschen in die neue Entscheidungsfindung einbinden, die mit den früheren Entscheidungen nichts zu tun haben.
- Deutlich machen, welche Konsequenzen es hat, wenn eine frühere schlechte Entscheidung revidiert wird – ökonomisch und emotional für die Betroffenen.
- Die Gründe hinterfragen, warum eine Entscheidungsrevision schwerfällt: Wovor haben die Betroffenen Angst?
- Eine angemessene Fehlerkultur etablieren und pflegen, damit sich die Mitarbeitenden trauen, falsche Entscheidungen zu revidieren.
Do's und Don'ts im Prozess der unternehmerischen Entscheidungsfindung
Nicht nur in den Denkgewohnheiten lauern Entscheidungsfallen, auch im Prozess selbst können viele Fehler gemacht werden, die zu schlechten Entscheidungen führen.
Bei jeder weitreichenden Entscheidung im Unternehmen gilt es zu bedenken:
- Entscheidungsziel klar formulieren: Was soll erreicht oder vermieden werden?
- Bewertungs- oder Entscheidungskriterien gut überlegen, klar beschreiben und selbst entwickeln, also nicht durch andere (Interessenvertreter) vorgeben lassen.
- Entscheidungskriterien sollten sich nicht zu sehr ähneln, sonst werden einzelne, übergeordnete Aspekte zu stark gewichtet.
- Alternativen entwickeln und deutlich machen, worin sich diese unterscheiden.
- Daten, Fakten und Informationen nicht einseitig auswählen, präsentieren, interpretieren und als „wahr“ hinnehmen, obwohl Quelle und Messung unklar sind.
- Schätzungen und Prognosen immer hinterfragen.
- Messinstrumente, Fragebögen, Bewertungsmethoden, Formulierung der Entscheidungsfrage oder die Präsentation der Ergebnisse können einen Einfluss auf die Entscheidung selbst ausüben.
- Alternative Wahlmöglichkeiten nicht als Entweder-oder-Entscheidung aufbereiten, sondern Kombinationen aus Vorteilen mehrerer Alternativen zulassen.
- Entscheidungen am Sachverhalt selbst ausrichten und nicht treffen, weil die Zeit drängt, jeder zufriedengestellt werden soll oder persönliche Eitelkeiten wichtiger sind.
- Entscheidungen nicht aussitzen, bis es nichts mehr zu entscheiden gibt.