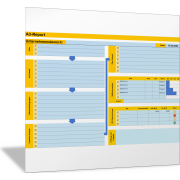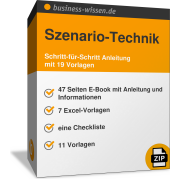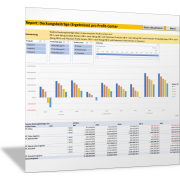UnternehmensgründungDiese rechtlichen Stolperfallen sollten Gründer kennen
Gründen heißt Verantwortung übernehmen. Nicht nur für die eigene Idee, sondern auch für zahlreiche rechtliche, steuerliche und organisatorische Pflichten.
Wer sich hier nicht frühzeitig informiert, tappt schnell in teure Fallen. Viele davon lassen sich mit etwas Vorbereitung leicht vermeiden.
Die Wahl der Rechtsform – mehr als eine Formalität
Ob Einzelunternehmen, GbR, UG oder GmbH: Die Wahl der Rechtsform entscheidet über Haftung, Steuerlast, Gründungskosten und vieles mehr. Besonders problematisch wird es, wenn Gründerinnen und Gründer ohne Beratung eine vermeintlich einfache oder kostengünstige Rechtsform wählen – und später merken, dass sie für Schulden oder Verträge persönlich haften.
Tipp: Holen Sie sich frühzeitig rechtlichen oder steuerlichen Rat. Wer mit Partnern gründet, sollte unbedingt einen Gesellschaftsvertrag abschließen.
Die Haftungsfalle: Persönlich haften, ohne es zu merken
Gründer haften oft persönlich, bevor das Unternehmen überhaupt im Handelsregister eingetragen ist (zum Beispiel bei der GmbH). Das nennt sich „Gründer- oder Handelndenhaftung“.
Auch die Nichtzahlung von Gerichtskosten für die Handelsregistereintragung kann zur Ablehnung der Gründung führen.
Tipp: Betriebswirtschaftliche und rechtliche Formalitäten nicht aufschieben. Die Gründung ist erst mit Eintragung und korrekter Anmeldung abgeschlossen.
Genehmigungen, Anmeldung und „vergessene“ Voraussetzungen
Nicht jedes Business darf einfach so starten. Gerade im Bereich Handwerk, Gastronomie, Gesundheit oder Bildung benötigen Gründerinnen und Gründer spezielle Genehmigungen, Erlaubnisse oder Eintragungen.
Dazu gehören beispielsweise der Eintrag in die Handwerksrolle, Konzessionen oder Hygieneschulungen.
Auch Coaches müssen wissen: Wer mit psychisch erkrankten Menschen arbeitet, bewegt sich schnell im heilkundlichen Bereich – was ohne Zulassung nicht erlaubt ist.
An viele rechtliche Einschränkungen oder Voraussetzungen denkt man oft gar nicht. Ein Beispiel: Das Verwenden von Wohnraum als Geschäftsadresse kann problematisch sein, wenn es eine Zweckentfremdung ist.
Tipp: Informieren Sie sich bei der Industrie- und Handelskammer (IHK), bei der Handwerkskammer (HWK) oder den jeweiligen Berufsverbänden, welche Voraussetzungen in Ihrem Fall notwendig sind.
Falsche oder fehlende Angaben in der Gewerbeanmeldung
Ein häufiger, aber folgenschwerer Fehler: unvollständige oder falsche Angaben in der Gewerbeanmeldung oder dem steuerlichen Erfassungsbogen.
Gerade bei der Beschreibung der Tätigkeit ist Sorgfalt gefragt. Unklare oder unzutreffende Angaben können später zu Problemen mit der Behörde oder dem Finanzamt führen.
Tipp: Lassen Sie sich beim Ausfüllen helfen – zum Beispiel von einem Gründungscoach oder Steuerberater.
Steuerliche Stolperfallen – von Anfang an beachten
Viele denken erst spät ans Finanzamt. Dabei beginnt die steuerliche Verantwortung schon mit dem ersten Euro Umsatz.
Fehlerhafte Rechnungen, verspätete Umsatzsteuervoranmeldungen oder fehlende steuerliche Anmeldung können zu Nachzahlungen und Strafen führen.
Unrealistische Prognosen im Businessplan können ebenfalls steuerliche Risiken bergen.
Tipp: Melden Sie Ihr Unternehmen sofort beim Finanzamt an, füllen Sie den steuerlichen Erfassungsbogen sorgfältig aus und lassen Sie sich zur Kleinunternehmerregelung beraten.
Sozialversicherung, Rentenpflicht und Scheinselbstständigkeit
Viele Gründerinnen und Gründer starten aus der Arbeitslosigkeit oder in Teilzeit. Wer die Krankenversicherung nicht richtig informiert oder die eigene Tätigkeit falsch einschätzt, riskiert Nachzahlungen und Probleme mit der Renten- oder Unfallversicherung.
Für bestimmte Berufsgruppen, wie zum Beispiel Lehrende, Pflegende oder Hebammen, kann eine Rentenversicherungspflicht bestehen.
Auch das Risiko der Scheinselbstständigkeit wird oft unterschätzt. Bei Zusammenarbeit mit nur einem Auftraggeber droht die Einstufung als scheinselbstständig.
Tipp: Klären Sie Ihren Versicherungsstatus mit der Krankenkasse und informieren Sie sich über mögliche Pflichtversicherungen.
Datenschutz und Website: Kleine Fehler, große Wirkung
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gilt auch für Soloselbstständige. Schon eine unvollständige Datenschutzerklärung oder ein fehlendes Cookie-Banner auf der Website kann teure Folgen haben.
Zudem wird das Markenrecht oft unterschätzt: Logos, Slogans oder Domainnamen müssen rechtlich geprüft werden.
Tipp: Nutzen Sie professionelle DSGVO-Generatoren für Ihre Website und überprüfen Sie Ihren Firmennamen frühzeitig auf Markenrecht. Eine einfache Markenrecherche hilft, teure Abmahnungen zu vermeiden.
Fehlende Verträge und rechtliche Absicherung
Viele Gründerinnen und Gründer starten ohne klare Verträge – weder mit Kunden noch mit Partnern. Das rächt sich oft, wenn es zu Missverständnissen oder Streit kommt. Auch AGB und Datenschutzerklärungen fehlen häufig oder sind fehlerhaft.
Tipp: Nutzen Sie rechtssichere Vertragsvorlagen und holen Sie sich professionelle Hilfe bei der Erstellung von AGB, Datenschutzerklärung und Impressum.
Fazit: Vor der Gründung beraten lassen
Eine gute Idee ist wichtig – aber ohne rechtliches Fundament birgt sie Risiken. Gerade für Soloselbstständige, Gründende aus der Arbeitslosigkeit oder mit geringem Startkapital ist rechtliche Klarheit ein Muss.
Für die meisten Gründungsvorhaben ist es deshalb wichtig, sich vor dem Start beraten zu lassen. Anlaufstellen sind Steuerberatungen, Gründungscoaches, Kammern oder Berufsverbände. An vielen Orten gibt es auch besondere Einrichtungen, Beratungsstellen oder andere Initiativen, die bei der Gründung helfen.